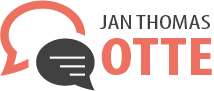Ob im Büroturm oder am Fließband. Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen werden händeringend gesucht. Wir fällen jeden Tag tausende Urteile, bewusst wie unbewusst. Gut, wenn wir dabei mit uns selbst im Reinen sind. Beispiel für eine Kolumne, erschienen in einer FAZ-Printausgabe…
Was zeichnet einen richtig guten Chef aus? Welches Handwerkszeug muss er mitbringen? Vor allem Erfahrung im Führen anderer Menschen solle er haben, sagt Benedikt von Nursia. Und meinte mit seiner Mönchsregel noch etwas Anderes. Von „reifem Charakter“ solle der Entscheider dafür sein. Mönche wie Anselm Grün oder Anselm Bilgri übersetzen diese Klosterweisheiten in Managerseminaren.
Dabei sprechen sie von auch Machtstreben und Eitelkeiten auf Vorstandsebenen. Selbst dann wenn stets „um die Sache“ gekämpft wird. Die Berater wissen aus der Seelsorge, was eigentlich jeder schon weiß, sich aber nicht jeder eingestehen will. Alle machen mal Fehler. Auch die Top-Manager. Mit dem Führungsstil des Managers ist mehr gemeint als das Herumkommandieren seiner Mitarbeiter. Persönlichkeiten sind gefragt, nicht die Narzissten oder Neurotiker.
Komplexität
Mitarbeiter wollen Entscheidungen ihres Chefs mittragen. Auch dann, wenn es um hohe Risiken geht wie an der Wall Street. Sie wollen verstehen, was der Vorgesetzte eigentlich meint. Und der sieht sich in der Bredouille seiner „Stakeholder“, sämtliche Gruppen die von seinen Entscheidungen profitieren – oder eben gerade nicht. Diese Erfahrung machte ein Top-Manager bei Blackrock. Am Vortag hatte in New York die Investmentbank Lehmann Brothers pleitegemacht, 15. September 2008. Dreißig Prozent der Mitarbeiter müssen zum Jahresende gehen, sagten die Analysten voraus. Seine Mitarbeiter lasen es am nächsten Morgen in der Zeitung.
Heute ist es andersrum. Finanzvorstand Robert Doll sucht händeringend neue, motivierte Mitarbeiter, um sie nach den „Lay-Offs“ der Krise wieder einzustellen. Eine Entscheidung um 180 Grad, wegen der Erholung auf den Aktienmärkten. Diese hat der Nummer Eins unter den Vermögensverwaltern neues Geld in die Kasse gespült. Im letzten Jahr steigerte BlackRock seinen Gewinn auf insgesamt 2,5 Milliarden Dollar. Momentan managt das Unternehmen um die 3,5 Billionen Dollar für seine Kunden. Weltweit. Mit die Bundesrepublik Deutschland wäre mit diesem Portfolio längst schuldenfrei.
Sicherlich. Entscheidungen für morgen werden nicht im luftleeren Raum getroffen. Sie haben ganz konkret mit ihrer Umwelt zu tun, der Realität. So wie sie vom Manager, seinen Mitarbeitern, Beratern und Kunden wahrgenommen wird. Dabei geht es um komplexe Kausalketten, will man alles bedenken, unter gar keinen Umständen etwas verkehrt machen.
Die Manöverkritik kommt gewiss: Was wurde gut gemacht? Was lief gründlich schief? Kein Mensch kann die Konsequenzen von Entscheidungen, welcher Art auch immer, exakt kalkulieren. Schon gar nicht prophezeien. Ihr Restrisiko bleibt, ebenso die Eigendynamik. Will man sich nicht rausreden mit Phrasen wie „Upps, das habe ich nicht gewusst“, wird es noch komplizierter. Ursache ist nicht gleich Wirkung, Reiz ungleich Reaktion, besagt die Systemtheorie Niklas Luhmanns.
Priorität
Ob die Meilensteine einer Bilanzpressekonferenz oder die Gewinnerwartungen der Aktionäre. Sie sind eng mit CEOs, den „Executives“ verknüpft. Das permanente Personalisieren erfordert, sich selbst treu zu bleiben, ein Stück weit zumindest. Jedenfalls keine Marionette zu werden die es links und rechts, oben wie unten allen Leuten recht machen will. Schaut man auf die Fluktuation der Führungskräfte der letzten Jahre, sieht die Realität anders aus.
Selbst hochdotierte Manager können sich ihrer Jobs „einfach nicht mehr sicher“ sein, sagen Studien des Headhunters Heidrick & Struggles. Zuverlässiges Verhalten schaffe aber Vertrauen in die eigenen Entscheidungen, glaubt man. Und innere Zufriedenheit, abhängig von der langfristigen „Performance“, dem Wert des Unternehmens. Mindestens genauso wichtig erscheint dabei das Selbstwertgefühl des Entscheiders.
Psychologen haben das mit verschiedenen Persönlichkeitsprofilen herausgefunden. Ihr Ergebnis: Am glücklichsten ist nicht der Manager, der besonders viele Ziele formuliert sondern derjenige, der sich davon abgrenzt. Also auch mal Nein sagen kann. Egal, ob man mit seinem Job gerade überfordert ist oder momentan Wichtigeres zu entscheiden hat.
Ein Szenenwechsel zum Sport. Fußballer müssen das Spiel auf dem Rasen für sich und ihre Mannschaft entscheiden, davon hängt alles Weitere ab. Damit man auf der Tabellenliste weiterkommt, Sponsoren und der persönliche Coach zufrieden sind. Die Mannschaft gehorcht den Befehlen des Kapitäns. Und der wiederum setzt alles daran, seine Kollegen wegen seinen Kompetenzen nicht zu enttäuschen. Ähnlich sieht das auch auf einem Segelschiff aus.
Der Management-Begriff „Kybernetik“ kommt nämlich von der Kunst, entschieden ein Schiff zu steuern. Das System an Bord ist bereits vorstrukturiert, jeder hat seine Aufgabe. Vorausgesetzt, alles funktioniert nach Plan. Und der Kapitän bleibt an Bord, statt sich aufs Beiboot zu retten. Menschen führen. Das bedeutet mehr als das Checken der Großwetterlage, Vermessen mit Karte und Kompass.
Authentizität
Orientierung braucht Zeit und Menschen, die einem zum Entscheiden ermutigen. Zwischen Business School und Büroalltag soll hier zum Beispiel eine sichere Andockstelle sein: St. Gallen, nahe dem Bodensee. Große Teile der Wirtschaftswelt hat man schon entdeckt.
Die Managementzunft sucht weiterhin nach neuen Horizonten. Dieses Jahr geht soll es in den Workshops und Vorträgen rund um das Thema „Just Power“ gehen. Für Manager und Mächtige und solche, die das an verschiedenen Orten werden wollen. Es gehe dabei auch um Charakter, sogenannte „weichen Faktoren“. Werte von Authentizität und Verlässlichkeit seien keine Nebensache, heißt es im Vorprogramm. In der Hauptsache wird aber über andere Themen geredet. Profitable „Mergers“ in den USA zum Beispiel, Zusammenschlüsse und Zukäufe von Unternehmen.
Noch ein Mal zurück an die Wall Street. Hinauf in die Chefetage von Blackrock, hinein in den hektischen Alltag der Hundert-Stundenwochen. Für Robert Doll steht die nächste große Entscheidung an. Diesmal geht es nicht um Personal, sondern um die Übernahme eines Wettbewerbers. Der Kaufpreis für Barclays Global Investors: 15 Milliarden Dollar. Zunächst entpuppt sich der Deal als Verlustgeschäft. Am Ende ging doch noch alles gut. Die Moral der Geschichte: Für beides, Verluste und Gewinne tragen Manager die Verantwortung. Weggelaufen ist er nicht. Doll hat einen Weg gefunden, mit seinem Berufsrisiko persönlichen umzugehen. Möglicherweise zum Buhmann der Nation zu werden, wenn er unbequeme Entscheidungen trifft.
Täglich erlebt der Top-Manager, wie der Leistungsdruck ihn und seine Vorstandsmitglieder zum Einzelkämpfer macht, machen kann. Damit ihm das so schnell nicht passiert, sucht er Abwechslung. Weder beim Golfen auf Long Island, der Kundenpflege, noch beim Veranstalten großer Benefiz-Galas an der Fifth Avenue (das Gros seines Vermögens spendet er sowieso wohltätigen Zwecken). In einer kleinen, unscheinbaren Kirche in Princeton, New Jersey. Dort leitet Doll ein Mal pro Woche den Gemeindechor. Regelmäßig, hat er gesagt. Auch dann, wenn es mal wieder später geworden ist.
Hinweis: Artikel ist zuerst erschienen in der Frankfurter Allgemeinen/ Hochschulanzeiger.