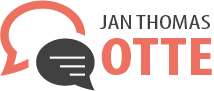Tradition verpflichtet. In Princeton studiert der Club der großen Lichter. 2008/09 durfte ich an der weltbekannten Elite-Universität studieren, diskutieren und forschen. Über meine Zeit dort u.a. als Fellow am Liechtenstein Institute on Self-Determination habe ich ein Tagebuch geschrieben – veröffentlicht in einer Wochenend-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, UNI&JOB…
28. August. Das Visum ist da, das Stipendium bewilligt, meine beiden Koffer sind gepackt. Es kann losgehen. Die Bewerbung hatte ich schon 2006 an die Uni
geschickt. Jetzt, zwei Jahre später, habe ich endlich alle bürokratischen Hürden genommen und sitze im Flieger nach Princeton.
Eine der angesehensten Hochschulen der Welt wartet auf mich. Ich habe schon sechs Semester Theologie an der Heidelberger Uni hinter mir, zwei Semester BWL im Fernstudium. Dazu passend will ich jetzt mit Wirtschaftsethik weitermachen. Wie die Studis und Profs wohl sein werden? Das Knuspern an den Fingernägeln kann ich mir nicht verkneifen.
2. September. Der Princeton-Campus ist so, wie ich ihn aus amerikanischen Collegefilmen kenne: gotische Gebäude mit Treppchen und Türmchen. Ich bin beeindruckt. Auf dem Green flanieren Studenten, das orangefarbene Princeton-Logo gut auf ihrem Poloshirt platziert.
10. September. Die erste Uni-Woche hat begonnen. Ich surfe im „Blackboard“, dem Netz, das Uni-Bibliothek und Seminar mit unzähligen PDF-Docs, Titeln und Teasern verbindet. Professoren stellen ihre Ordner und Materialien zum Unterricht rein. Ich soll sie lesen. Darin stehen die aktuellsten Texte, welche die Forschung zu bieten hat. Alles zu den Themen Theologie, Ökonomie und Ethik. Die Mitstudenten stöhnen. Das sei ein bisschen „too much“, sagt Jeremy Jinkins auf dem Flur im ,“Dorm‘“. In diesem Studentenwohnheim wohne ich, teile mir das Bad mit ihnen.
1500 Dollar Fixkosten pro Monat
Die Küche ist spartanisch eingerichtet, denn gegessen wird nur in der Mensa. Kostet zusammen etwa 1500 Dollar pro Monat. Das Leute-Kennenlernen ist in Princeton einfach. Eigentlich. Denn es wird viel vom „Campus & Life“-Komitee dafür getan. Nur hocken viele Studis schon zu Semesterbeginn mehr hinterm Schreibtisch als draußen auf dem Campus. Getroffen habe ich trotzdem einige Studis. Nicht nur beim Zähneputzen um Mitternacht. Auch vorher beim Biertrinken in den paar Kneipen oder Pfeife-Rauchen. Sie reden über vieles, locker, oberflächlich. Mein erster Eindruck: Smalltalk mit etwas Snobismus der Princetonians.
Besonders beliebt: Rudern in der „Ivy-League“, Bildungs-Elite-Rankings oder die besten „Eating-Clubs“ (elitäre Verbände ähnlich wie deutsche Burschenschaften). Liebe spielt in letzeren Kategorien eine untergeordnete Rolle.
25. September. Das erste Heimweh ist verflogen. Ich belege vier Seminare pro Semester. Das sind zehn Stunden pro Woche. Hört sich wenig an, aber für die paar Seminare muss ich ungewohnt viel büffeln. Die Klassen in Princeton sind klein, aber der Anspruch ist gross. Keiner will sich vor den zehn, zwölf Mitstudenten und seinem Dozenten blamieren. Im Unterschied zu Heidelberg sind die Profs zwar viel lockerer und immer freundlich.
Zugleich fordern sie aber auch mehr Engagement, Extra-Referate zum Beispiel und gründlichste Vorbereitung. Pro Semester schreiben Geisteswissenschaftler hier etwa 150 Seiten Essays. Die Themen dürfen gerne interdisziplinär sein. Super! Zum Glück kann ich bis Mitternacht in der Bibliothek arbeiten, in einem der schicken Ledersessel. Um mein Pensum zu schaffen, stehe ich schon um vier oder fünf wieder auf. Und schreibe über den Sinn von Managergehältern nach John Rawls Gerechtigkeitstheorie. Oder über ,“Die glaubensfreundliche Firma. Berufung christlicher Unternehmer in der Wirtschaft.“
13. Oktober. Aufruhr auf dem Campus. Star-Ökonom Paul Krugmann lädt zum Sektempfang. Der kritische Wirtschaftsdenker hat den Nobelpreis bekommen. Ich lasse meine Vorlesung am Nachmittag sausen, um wie die anderen Gäste im überfüllten Auditorium Maximum zu applaudieren.
4. November. Heute gehen meine Kommilitonen zur Wahl. Nachts um zwei klopft jemand an meine Tür: „Obama hat jetzt 53 Prozent der Stimmen“. Die Mehrheit auf dem Campus in Princeton war für Obama. Princeton ist das konservativste Lager der Ivy League. Harvard und Yale haben liberaler gewählt.
15. November. Es braucht wirklich Zeit, bis man sich an die Lerngepflogenheiten hier gewöhnt. Alles muss hyperschnell gehen: Lernen, Denken, Schreiben, Reden. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit? Fast. Meine ersten Kilos zu viel stehen auf der Waage, weil ich zu wenig Zeit habe, um Sport zu treiben.
Princeton und die „Pampa“
Wenigstens halten sich die vielen Eichhörnchen, die ich von meinem Schreibtisch aus beobachte, ausreichend in Form. Sie hüpfen stundenlang vergnügt um die Wette. Die Bäume haben schon ihre rotgelben Blätter des Indian Summers abgeworfen. Zu viel Natur? Nun ja. Princeton ist eben keine Großstadt. Wer hier herkommt, will lernen. Da kommt Ablenkung nicht so gut an. Nach New York werde ich trotzdem noch fahren.
6. Dezember. Nikolaus! Mit der „Dinky“, so nennen die Princetonians die Bahn, die eine Stunde und 15 Minuten bis Penn Station braucht, bin ich nach New York gefahren. Besonders schön finde ich den „Big Apple“ aber nicht. Etwas laut und stinkig. Im Gedächtnis geblieben sind mir viel mehr Chagall-Bilder im Metropolitan Museum oder Break-Dancer im Central Park.
9. Februar. Der Februar ist auch in New Jersey ziemlich ätzend. Grauer Himmel und immer wieder Temperaturen um minus 20 Grad. Im Wohnheim schwitze ich trotz Minimalbekleidung oder friere, obwohl ich meinen dicksten Pulli anhabe. Die Klimaanlage scheint so alt zu sein wie Princeton selbst. Irritiert bin ich auch über die 24-Stunden-Beleuchtung auf dem Weg zum Bad. Wenn ich mit meinen Kommilitonen darüber spreche, bin ich schnell der Öko-Mann aus Deutschland. Für sie gilt: „Security first“.
„Keine Donald-Duck-Uni“
15. März. Nun sind sechs von neun Monaten vorbei. Ich habe in dieser Zeit so viel gelesen und geschrieben wie in meinem gesamten Heidelberger Studium, immer mit Unterstützung eines Professors. Diesen ,,Advisor‘‘ konnte ich mir aussuchen. Er trifft sich regelmäßig mit mir in der Mensa, um über Gott und Geld zu reden. Mir fehlt es an Schlaf, mehr als vier Stunden Bettruhe pro Nacht sind weiterhin nicht drin.
20. Mai. Heute findet das Commencement statt, die Abschlussfeier in der Uni-Kapelle. Wir Studenten sind total aufgedreht, großer Promi-Auflauf: Ob UN-Generalsekretär oder Gattin des US-Präsidenten, in Princeton gehen sie alle ein und aus. „Keine Donald-Duck-Uni“, scherzt ein Besucher. Es folgt der Marsch der Absolventen durch die mit 2’000 Menschen besetzte Fest-Kathedrale.
Die Orgelpfeifen dröhnen. „Sie sind etwas ganz Besonderes“, versichern die Redner den stolzen Absolventen. Ein erhebendes Gefühl am Ende der Strapazen. In Robe und Hut schreiten sie zwischen blühenden Magnolien ein letztes Mal über den Campus. Mein Examen in Heidelberg wird schlichter sein. Morgen fliege ich nach Hause. Das ist schade. Aber ich bin auch froh, wieder herunterzukommen von der hohen Geschwindigkeit, die hier herrscht.
Eine dreiteilige Kolumne über die Eindrücke meiner ersten vier Wochen an der renommierten Hochschule habe ich im Internet veröffentlicht (E-Fellows.Net Karriere-Netzwerk, München 2008). Sowie beim Karriere-Portal Staufenbiel. Und meinem Reisemagazin, admirado.